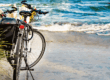Man spricht deutsch, hochdeutsch, um ganz präzis zu sein. Auch in der Schweizer Reisebranche. Swiss und Edelweiss gehören der Lufthansa, aus dem Reisepionier Imholz ist vor einiger Zeit die Schweizer Dependance von Tui entstanden. Und vor eineinhalb Jahren ist auch noch Kuoni Schweiz an die deutsche Rewe-Gruppe verkauft worden. Der deutsche Appetit auf Schweizer Unternehmen scheint ungebrochen zu sein. Dies obwohl die beiden benachbarten Länder noch nie durch eine besonders harmonische Liebesbeziehung aufgefallen sind. Im Gegenteil: Immer wieder wird in den Medien genüsslich vom angeblich angespannten Verhältnis zwischen Deutschen und Schweizern berichtet.
In der Debatte in unserem Land sind aber auch zunehmend germanophile Stimmen aus zu machen. «Deutsche machen glücklich», schrieb beispielsweise eine Tageszeitung nach dem beeindruckenden Auftritt der deutschen Fussball-Nationalmannschaft an der WM in Brasilien. Und im Gesundheits- und Bildungswesen scheint gar Einigkeit zu herrschen: Spitäler und Hochschulen könnten ohne die zahlreichen Fachkräfte aus Deutschland gar nicht mehr funktionieren. Wieso also hapert es noch mit der Liebe? Ein Schelm, der behauptet, Schweizer könnten die Deutschen gar nicht lieben, weil sie ihnen zu viele nationale Symbole zu verdanken hätten. Die fromme Schweizer Seele ahne: Ohne Friedrich Schiller wäre Wilhelm Tell nicht viel mehr als eine historisch umstrittene Randnotiz, aber sicher kein Nationalheld. Und ohne die deutschen Manager Christoph Franz, Harry Hohmeister und Thomas Klühr gäbe es über dem Schweizer Strahlenmeer keinen nationalen Flugstolz mehr zu besingen.
Gleichwohl – oder vielleicht gerade weil zahlreiche Schweizer Unternehmen gegenwärtig von ausländischen Investoren übernommen werden – erlebt die «Swissness» einen ungeahnten Höhenflug. Wir haben uns mit den deutschen CEOs von Edelweiss und Kuoni Schweiz zu diesem Thema unterhalten. Das Interview mit Airline-Chef Bernd Bauer finden Sie in der gedruckten Juni-Ausgabe auf der Seite 50, die Aufzeichnung des Gesprächs mit Reiseveranstalter Dieter Zümpel in der gleichen Nummer auf Seite 38.
Schweizerisch-deutsche Dissonanzen gab es bereits während der Reformationszeit. Auf den Zürcher Kirchenlehrer Ulrich Zwingli hielt Martin Luther offenbar keine grossen Stücke. In einem Beitrag in der Mai-Ausgabe von NZZ-Geschichte schreibt der Historiker Volker Reinhardt: «Für Luther war ‹Zwingel›, wie er ihn herabmindernd nannte, ein Schwärmer, modern ausgedrückt: ein Radikaler, der Utopien nachhing und nachjagte. Zwinglis Tod auf dem Schlachtfeld von Kappel im Oktober 1531 war für Luther die göttliche Bestätigung dieses harten Urteils.» Die Zürcher Kirche – erstaunlich eigentlich – trägt dem deutschen Augustinermönch dessen Geringschätzung gegenüber Zwingli bis heute nicht nach. Im Gegenteil: Sie feiert das diesjährige deutsche Reformationsfest so, als wär’s das eigene. Und wir geben’s zu: Auch wir wollten nicht auf das Zwingli- oder Calvin-Jubiläum warten und sind 500 Jahre nach der Veröffentlichung von Luthers Thesen ebenfalls an einige der Originalschauplätze der deutschen Kultur- und Kirchengeschichte gereist. Unsere Autorin Stefanie Zeng hat Thüringen besucht. Ihren Bericht lesen Sie hier.
Von Markus Weber