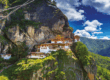Begegnungen am Sepik River, dem rund tausend Kilometer langen Strom in Papua-Neuguinea, zählen zu den letzten grossen Abenteuern unseres Planeten.
Guide Chris Nick (57) schüttelt den Kopf. Nein, Baden wäre hier keine so gute Idee. Chris ist am Karawari River aufgewachsen, einem grossen Nebenlauf des Sepik. Er muss es wissen: «Im Fluss leben Leistenkrokodile, die zwischen dem Sepik und dem offenen Meer pendeln. Das Fischangebot im Fluss ist zwar üppig, aber manchmal haben die Krokos Appetit auf etwas Neues.» Dann kraxelt Chris die Böschung hinab und steigt vorsichtig und mit viel Balance-Gefühl in den Bug eines wackeligen Einbaums. Still schneidet das Kanu anschliessend durch das dunkle, geheimnisvolle Wasser. Chris scannt mit seinen scharfen Augen das schilfbewachsene Ufer. Da! Nur wenige Meter von uns entfernt gleitet ein grosses Krokodil in die Fluten. Die Augen funkeln wie ein warnendes Ausrufezeichen.
Der Sepik ist wild und unberechenbar. Ihn zu befahren ist auch heute noch ein nicht zu unterschätzendes Abenteuer, wenn auch nicht mehr ganz so gefährlich wie früher. Die ersten Missionare, die ihn von der Mündung flussaufwärts erkunden wollten, wurden mehrheitlich von den an seinen Ufern lebenden Stämmen getötet. Heute ist die bequemste und sicherste Art, sich dem Sepik zu nähern, aus der Luft. Strassen, sofern sie überhaupt existieren, sind in Papua-Neuguinea meist aufgeweichte Schlammpisten.
An den Nebenfluss Karawari gelangt man ebenfalls am einfachsten mit einer einmotorigen Propellermaschine. Sie gehört dem Australier Bob Bates, der in Papua-Neuguinea oder kurz PNG als Tourismus-Pionier gilt. «Es gibt kein schöneres Land auf der Welt, um abzuheben», ist Bates überzeugt, der inzwischen mehr als 10 000 Flugstunden auf dem Buckel hat. Der Australier hat nahe seiner Karawari Lodge – der einzigen Unterkunft am Sepik, die westlichen Standards entspricht – den Regenwald roden lassen, um hier landen und starten zu können. Mit dem Boot erreicht man in einer halben Stunde bequem die Lodge, deren Hauptgebäude mehr als hundert Meter über dem Fluss thront. Von der Veranda aus blickt man bis zum Horizont über Regenwald, im Inneren auf Schnitzereien, denen Schlangen aus dem Mund kriechen, und Masken, die mit getrockneten, muschelbesetzten Fledermäusen geschmückt sind. Die Kunstwerke aus den Dörfern an den Ufern des Sepik und seiner Zuflüsse sind weltberühmt und entsprechend teuer. Man findet sie selbst in New Yorker Galerien.
Am nächsten Tag geht es schon frühmorgens hinab zum Ufer des 300 Kilometer langen Karawari. Angedockt liegt dort die «Sepik Spirit», die Bates 1989 exakt nach seinen Wünschen bauen liess, um Flusskreuzfahrten anzubieten. Inzwischen ist sie etwas in die Jahre gekommen und wird demnächst überholt. Für unseren Ausflug zu den weiter entfernt lebenden Stämmen wäre sie ohnehin zu gross und zu langsam. Wir steigen deshalb in ein Schnellboot und die mit Blättern der Sagopalme gedeckten Hütten der umliegenden Dörfer fliegen an uns vorbei. Noch liegt Nebel über dem Fluss. In den Baumkronen entdecken wir Tukane und Kakadus. Einige von Bates‘ Gästen kommen ausschliesslich der Paradiesvögel wegen. Die Lodge gilt denn auch als eine der besten Adressen für Ornithologen.
Das Boot legt beim Dorf Kundiman an. 300 Menschen leben hier. Einige von ihnen treiben mit den Orten in der Nähe der Küste Handel und tragen deshalb westliche Kleidung. Andere sind noch völlig ihren Traditionen verhaftet. Besonders an Festtagen werfen sie sich in Schale und zelebrieren die «guten alten Zeiten», als nach erfolgreichen Kriegen und Kopfjagden Siegestänze in voller Bemalung aufgeführt wurden. Die Frisuren der Männer sind ein echter Hingucker, einige tragen Kuskus-Felle auf dem Kopf, einer Säugetierart, die sie regelmässig auf der Jagd erbeuten. Stolz zeigen uns die Männer ihr Geisterhaus, in dem die Schädel getöteter Feinde aufgereiht sind. Kannibalismus war weitverbreitet, sie schämen sich nicht dafür. Die Frauen demonstrieren derweil, wie sie Sago-Mehl herstellen. Die faserige Pflanze liefert nicht nur Baumaterial, sondern spendet auch das wichtigste Grundnahrungsmittel. Ansonsten werden den Frauen jedoch nicht viele Rechte zugesprochen, räumt Chris ein. Sie dürfen sich nur im Familienhaus aufhalten, das Geisterhaus ist für sie tabu. Nur für westliche Touristinnen wird ab und zu eine Ausnahme gemacht.
In Tanganimbit weiter flussaufwärts lebt ein anderer Stamm: Die Kombrop, erzählt Chris, stammen aus den Bergen und lebten früher in Höhlen. Die Australier, die frühere Mandatsmacht in PNG, zwangen sie, an den Fluss zu ziehen. Viele von ihnen infizierten sich im Tiefland mit Malaria. Wen das Sumpffieber besonders schlimm erwischt, der muss in die nächste Busch-Klinik. «Drei Tage dauert die Reise mit dem Boot», sagt Chris, «viele schaffen das nicht.»

Kopfjäger und rivalisierende Clans
Abends erzählt Bates auf der Veranda seine Geschichte. Nördlich von Sydney aufgewachsen, kam Bates als Ingenieur in den Ostteil der Insel, der von Australien als Treuhandgebiet verwaltet wurde. Der Westteil, das ehemalige Niederländisch-Indien, war 1962 von Indonesien annektiert worden und bildet heute dessen Provinzen Papua und Papua Barat. Dort hatte sich seinerzeit der berühmteste Fall von Kannibalismus ereignet, für den die Insel lange Zeit berüchtigt war. Michael Rockefeller, Spross der damals zweitreichsten Familie der USA, war 1961 während einer Expedition an der Südküste spurlos verschwunden. Es gilt als so gut wie erwiesen, dass er dem Stamm der Asmat in die Hände fiel, die wegen ihrer Kopfjagd gefürchtet waren.
Tödliche Kämpfe zwischen rivalisierenden Clans im Hochland soll es bis heute geben. Port Moresby, die Hauptstadt von PNG, gilt als eine der gefährlichsten Metropolen der Welt. Wie Bates hier vor vierzig Jahren auf die Idee kam, ein Reiseunternehmen zu gründen, ist uns ein Rätsel. «Zuerst habe ich im Auftrag der australischen Regierung Strassen, Brücken und Busch-Kliniken geplant», erzählt Bates. 1964 habe es nur zwei Flugplätze im ganzen Land gegeben. Trotzdem faszinierte Bates dieses Land mit seinen rund eintausend Stämmen, die 800 verschiedene Sprachen sprechen.
Was ihm gefiel, dachte er sich, könnte auch andere begeistern. Anfang der 70er-Jahre kündigte er deshalb seine Festanstellung und kaufte sich sein erstes Flugzeug, eine Cessna 182. Mit dem Viersitzer flog er weiterhin für die «Aussies» über die Insel, überall entstanden jetzt rustikale Start- und Landebahnen. Parallel dazu baute er eine Reiseagentur auf. «Ich merkte aber schon bald, dass das so nicht funktioniert», erzählt er. «Es gab praktisch keine Infrastruktur.» Kurz nachdem die Australier das Land 1975 in die Unabhängigkeit entlassen hatten, liess Bates am Sepik-Fluss seine erste Unterkunft, die Karawari Lodge, bauen. Im Umkreis von mehreren hundert Kilometern gab und gibt es auch heute noch keine Strasse. Die Nabelschnur zur Aussenwelt ist der Fluss. Oder der Flugstreifen mitten im Dschungel.
Stolze Krokodilmänner
Von der Aussenwelt unbeeindruckt und für uns eines der Highlights der Reise sind die berühmten «Krokodilmänner» des Sepik-Beckens. Auf dem Rücken tragen sie parallele Reihen wulstiger Narben, die wie Krokodilschuppen aussehen. Wenn Jugendliche erwachsen werden, lassen sie sich schneiden. In die Wunden wird Schlamm gegeben, später werden sie wieder geöffnet und mit Sagomehl beschmiert. Die Verletzungen sollen sich entzünden und so besonders wulstige Narben bilden. So will es die Tradition. Der 24-jährige Timi ist ein Krokodilmann. Er wirkt schüchtern, hat aber die Figur eines Zehnkämpfers. Timi kommt aus dem Dorf Abananken vom Stamm der Yokoim, so wie Chris. Das Krokodil ist in seiner Religion der grosse Kreator, der Erschaffer der Welt. Timi hat die Folter der langwierigen Narbenprozedur heil überstanden, zumindest physisch. Er geniesst seinen besonderen Status, geht zu Beratungen der Dorf-Oberen mit nacktem Oberkörper, hat einen höheren Marktwert bei den Frauen, auch bei jenen anderer Stämme. «Sie sind verrückt nach Krokodilmännern, allerdings ist Sex nach der Prozedur für eine bestimmte Zeit verboten», erklärt Chris. «Und die Narben dürfen von den Frauen während des Aktes nicht berührt werden.» Als Chris für Timi übersetzt, was er eben erklärt hat, lacht dieser. Er will wissen, ob es auch in Europa Krokodilmänner gebe. Wir verneinen, fügen aber aus Rücksicht auf seinen Stolz hinzu: «Natürlich nur deshalb nicht, weil es keine Krokodile gibt.»
Von Günter Kast